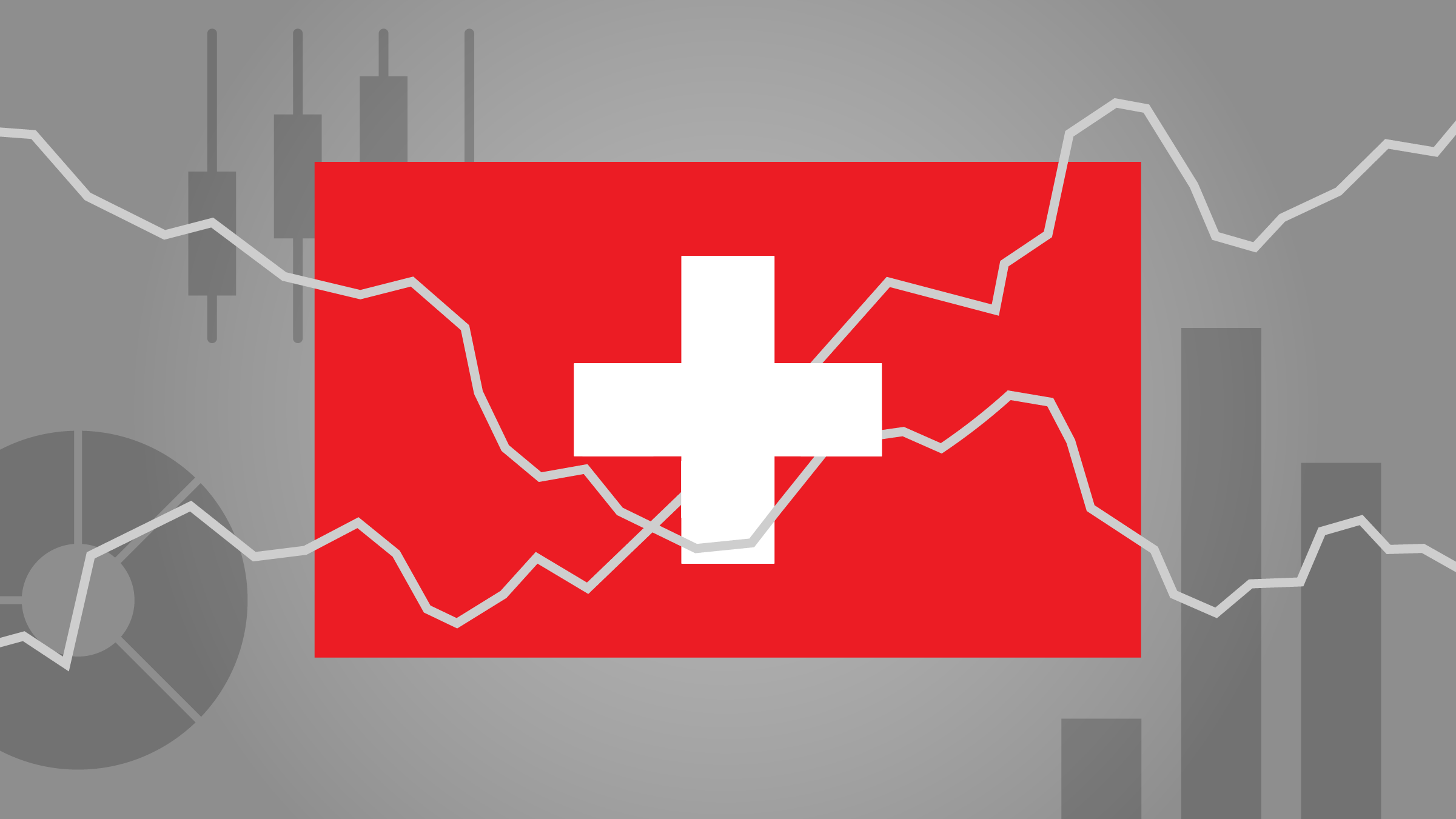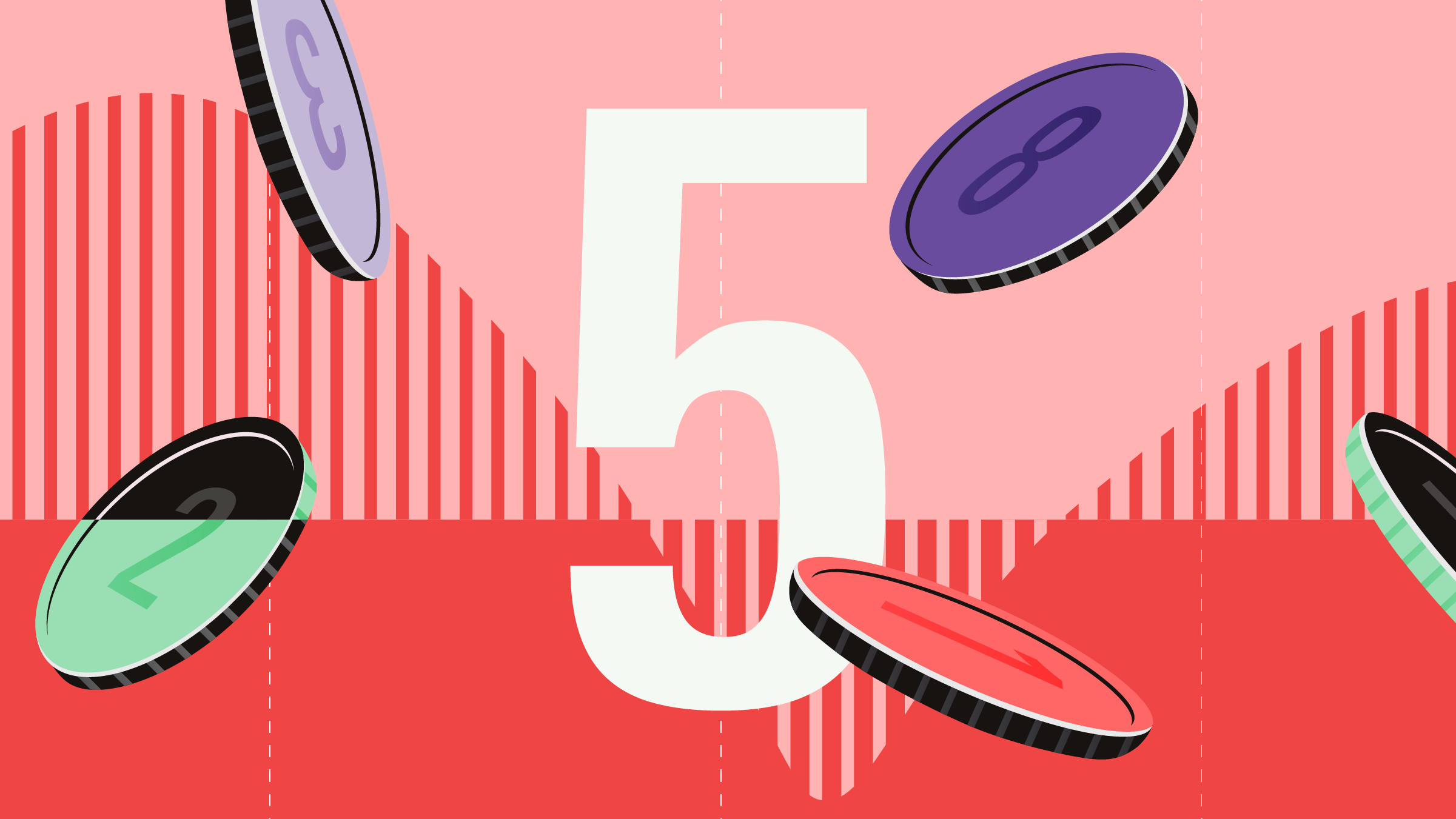Natürlich sind die 1950er und 1990er Jahre nicht zu toppen. Der US-Aktienmarkt stieg in den beiden Dekaden rasant. Aber wenn man sein Geld in weniger als einem Jahrzehnt real verdreifachen konnte, dann ist das auch nicht schlecht. So geschehen zwischen 2009 und heute. Der US-Aktienmarkt verzeichnete einen höchst respektablen Zuwachs – der zudem mit einer geringen Volatilität und wenigen grossen Umkehrungen und zugleich bei gedämpfter Inflation stattfand. Das macht die derzeitige Hausse umso beachtlicher. Doch es gibt einen wichtigen Schönheitsfehler: Niemand hat sie kommen sehen.
Natürlich ist diese Aussage nicht ganz richtig. Es hat ganz sicher jemanden im Irgendwo gegeben, der am Tiefpunkt des Marktes 2009 empfahl, Portfolios mit Aktien bis zum Anschlag vollzuladen. Aber es waren ganz sicher nicht viele. Das beste Beispiel, an das ich mich erinnern kann, war Jeremy Grantham von GMO, der im Januar 2009 erklärte, dass Aktien zwar „nicht dramatisch billig“ seien, ein Investment sich aber lohnen würde. Seine Losung: Er erwarte, dass Aktien in den nachvollgenden sieben Jahren eine Rendite von 65 Prozent erwirtschaften würden. Das war nur halbwegs korrekt – die Wertsteigerung belief sich in diesem Zeitraum auf 130 Prozent.
Im Nachhinein hatten die Ökonomen 2009 den richtigen Ausgangspunkt identifiziert. Sie prognostizierten, dass eine einzige, überwältigende wirtschaftliche Entwicklung die Börsenergebnisse des nächsten Jahrzehnts bestimmen würde. Leider konnten sie diesen Trend nicht erkennen und betonten stattdessen zwei Vorhersagen, die sich nicht bewahrheiteten.
Die neue Normalität
Der wirtschaftliche Konsens, der sich aus den Trümmern des Jahres 2009 ergab, war die Ankunft des „New Normal“, der „Neuen Normalität“, einer Zeit mit unterdurchschnittlichen Kapitalmarktrenditen, so die Prognose vieler Ökonomen. Über Jahrzehnte hinweg hätten die Vereinigten Staaten ihre Wirtschaft durch Defizitausgaben belastet, unterstützt und begünstigt durch die Kreditaufnahme der Verbraucher. Die Rechnung sei nunmehr fällig. Um sie zu bezahlen, würde die Nation gezwungen sein, den Gürtel enger zu schnallen, also: Ausgaben kürzen und Bilanz stärken. Diese Massnahmen würden das BIP-Wachstum auf Jahre hinaus dämpfen und damit die Aktienkurse negativ beeinträchtigen.
Die Analyse war im Grossen und Ganzen richtig, die Schlussfolgerung allerdings nicht. Die Gürtel wurden enger gezogen (nicht lange, wohlgemerkt weder die US-Bürger noch die Regierung mögen es zu knausern), und die Expansion des BIP war tatsächlich gedämpft. Nicht einmal während der Erholung erreichte das jährliche reale BIP-Wachstum, gemessen von einem Kalenderjahr zum nächsten, die Drei-Prozent-Marke.
Die Prognostiker übersahen allerdings, dass das BIP-Wachstum keine grosse Rolle für die Aktienmärkte spielt. Das hätten sie wissen müssen. Sieben Jahre zuvor hatten drei Professoren das Buch „Triumph of the Optimists“ verfasst. Unter grossem Beifall hatten sie gezeigt, dass es keinen nennenswerten Zusammenhang zwischen dem allgemeinen Wirtschaftswachstum eines Landes und der Entwicklung seines Aktienmarktes gibt.
Der Anstieg des BIP signalisiert zwar eine erhöhte Aktivität, gibt aber keine Auskunft über die Frage, wer von dieser Aktivität profitiert. Es könnten Oligarchen sein, die den Output der Nation auf ihre Offshore-Bankkonten verschieben. Es könnte der Faktor Arbeit sein, der diese Vorteile in Form von Lohnerhöhungen verschlingt. Es könnten ambitionierte CEOs sein, die das Geld in unrentable neue Projekte stecken. Es gibt also viele Möglichkeiten, das BIP-Wachstum zu steigern, die nichts mit der Erhöhung der Unternehmensgewinne zu tun haben müssen.
Anders die Konstellation in den USA 2009ff.: Nach der Finanzkrise befeuerte jeder Cent des BIP-Wachstums die Unternehmensgewinne. Und noch mehr: US-Unternehmen haben seither so viel Geld verdient wie nie zuvor. Vor 2010 hatte der reale Gewinn pro Aktie des S&P 500 nur zweimal die 80 Dollar-Marke überschritten (2005 und 2006). Seit 2010 liegen sie jedes Jahr über dieser Marke und erreichten 2017 einen Rekordwert von 111 Dollar. (Die Margen waren unter anderem deshalb so hoch, weil die Arbeitnehmer sich mit Lohnforderungen zurückhielten, was die Unternehmenskosten niedrig hielt, und zudem haben Unternehmen bei grossen Kapitalinvestitionen Verzicht geübt).
Letztlich werden die Aktienkurse von zwei Faktoren bestimmt: Unternehmensgewinne und Inflation. Das „Neu Normal“-Szenario unterschätzte den ersten der beiden Punkte ganz erheblich.
Quantitative Lockerung
Gleichzeitig waren die Ängste über die Auswirkung der expansiven Linie der Notenbanken, vor allem die zum „quantitative Easing“, auf die Inflationsentwicklung übertrieben. Nach der Finanzkrise galt es, die Volkswirtschaften zu stimulieren. Aber das erwies sich als schwierig, weil die kurzfristigen Zinssätze nahe Null lagen. Es setzte die unkonventionelle Notenbankpolitik ein, die so genannte quantitative Lockerung, welche die Anleihekurse stützte und die Geldmenge erhöhte.
Für Kritiker (von denen es viele gab) war die Medizin schlimmer als die Krankheit. Eine Versorgung der Wirtschaft mit Geld in dem Ausmass werde unweigerlich zu einer Inflation führen - wenn nicht früher, dann sicher später. In den Worten eines Pessimisten ausgedrückt: „Es besteht die Gefahr, dass die Inflation die Blase am Rentenmarkt zum Platzen bringt und zu einem Kollaps des US-Währungssytems führt. Dann brechen die Finanzmärkte ein, die Banken stürzen in eine neue Krise, das Vertrauen bricht zusammen und die Wirtschaftsaktivität kollabiert“.
Das ist alles offensichtlich nicht geschehen. Die Bond-Kurse bleiben fest, der Dollar hat seitdem gegenüber den anderen wichtigen Weltwährungen an Stärke gewonnen, die US-Banken haben keine neue Krise erlitten, das Verbrauchervertrauen ist in Ordnung, und die Wirtschaftstätigkeit ist stetig gestiegen. Keine der Doomsday-Prophezeiungen erfüllte sich.
Ein Grossteil des Arguments gegen die quantitative Lockerung war politisch motiviert. Man ist versucht zu ätzen, dass an dem Tag, an dem ein Mitglied des US-Kongresses eine ausgewogene makroökonomische Vorhersage macht, die Sonne nicht aufgehen wird. Doch auch viele Profis aus der Finanzbranche können sich nicht aus der Verantwortung stehlen. Wieder einmal hatten sie ihre Software nicht aktualisiert. Ende des letzten Jahrzehnts war klar geworden, dass die traditionelle Verbindung zwischen Geldmenge und Inflation schwach geworden war. Sie hätten ihre Optionen besser abwägen müssen.
Vier Schlussfolgerungen lassen sich ziehen:
1) Die Kombination aus anhaltend hohen Unternehmensgewinnen und niedriger Inflation erklärt den „Great Bull Market“. Die Kursgewinne gehen auf Zahlen und Fakten zurück, nicht auf die Stimmung der Investoren;
2) Wirtschaftsprognosen hinzubekommen, ist eine sehr schwierige Angelegenheit. Um das zu schaffen, muss man in vielen Dingen richtig liegen. Und oft reicht nicht einmal das, wer drei grosse Ereignisse voraussieht, aber ein viertes verpasst, hat nicht unbedingt eine genauere Vorhersage als jemand, der ständig falsch liegt;
3) Zu oft verleiten Konjunkturprognosen zum Gruppendenken. Nach der Finanzkrise 2008 wurde zu viel Aufmerksamkeit auf das „New Normal"- Paradigma gelenkt, während alternative Sichtweisen wenig beachtet wurden;
4) Neue Sachlagen erfordern neue Gedanken! Alte Gewohnheiten sind schwer abzustreifen, aber man muss mit ihnen brechen, wenn man für seine Investments die besten Ergebnisse erzielen will.