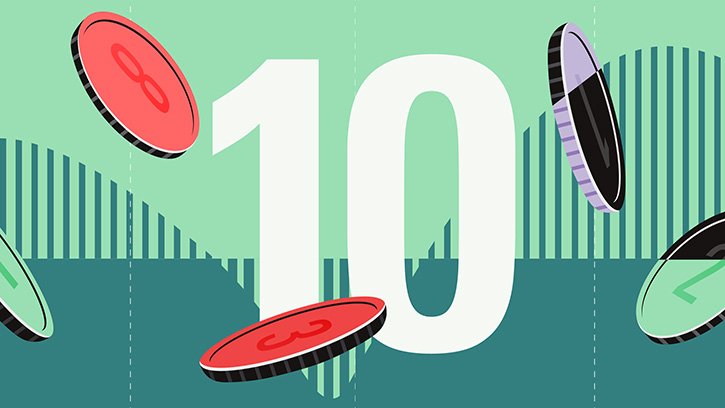Die Emerging Markets-Erfolgsgeschichte hat in den vergangenen Monaten erhebliche Kratzer bekommen. Seitdem die US-Notenbank Ende Mai das Ende ihrer expansiven monetären Politik andeutete, werden die Kapitalmärkte in den Entwicklungsländern von Turbulenzen erfasst. Ausländische Anleger ziehen in grossem Stil ihre Gelder ab. In den drei Monaten per Ende August büsste der MSCI Turkey knapp 30 Prozent ein. Der Aktienmarkt Indonesiens verlor gut 25 Prozent, die Börse in Indien brach um gut 20 ein und Thailand-Aktien verloren 19,6%. Auch bei Bonds ging es deutlich abwärts. Der marktbreite Bond-Index JPMorgan EMBI Diversified verlor 10,1 Prozent im selben Zeitraum - mehr als der breit streuende MSCI Emerging Markets Aktienindex.
Was ist passiert? Auch wenn vermutlich einiges zusammengekommen ist, dürfte der Wechsel in der Geldpolitik der USA eine entscheidende Wende im Investitionsverhalten westlicher Anleger eingeleitet haben. Die sich abzeichnende Reduzierung der Anleihekäufe durch die US-Notenbank (QE 3), die vor dem Hintergrund der Erholung der US-Konjunktur erfolgen wird, hat bereits die Anleiherenditen in den USA deutlich nach oben getrieben. In den vergangenen Tagen kratzten die Renditen von zehnjährigen Treasuries an der Drei-Prozent-Marke. Auch zehnjährige deutsche Bundesanleihen rentierten zeitweilig bei mehr als 2,0 Prozent. Ein weiterer Anstieg der Renditen ist nicht von der Hand zu weisen.
Viele Gründe für die Turbulenzen in den Schwellenländern
Derzeit werden die bisher verschmähten sicheren Staatsanleihen der Industrieländer attraktiver. Im selben Masse nimmt die Attraktivität von Anlagen in Schwellenländern ab. Carry-Trades werden in grossem Stil glattgestellt. In den vergangenen drei Monaten sind hohe Kapitalabflüsse aus Anleihen und Aktien der Schwellenländer zu beobachten. Mit den oben geschilderten Folgen für die lokalen Bond- und Aktienmärkte.
Natürlich gibt es auch jenseits der Geldflüsse auch fundamentale Gründe für die Unruhen an den Schwellenländer-Märkten. Das Wirtschaftswachstum schwächt sich deutlich ab. Nach jüngsten Schätzungen des Internationalen Währungsfonds wird sich das BIP-Wachstum Chinas in diesem Jahr auf 7,8% verlangsamen und in Indien auf 5,6 Prozent zurückgehen. Russland und Brasilien dürften nach IMF-Schätzungen nur noch mit je 2,5 Prozent wachsen. Zum Vergleich: 2007 legte China ein Rekordwachstum von 14,2% hin, Indiens Wirtschaft wuchs um 10,1 Prozent, Russland und Brasilien mit beachtlichen 8,5 bzw. 6,1 Prozent.
Hinzu kommen politische und soziale Unruhen in Ländern wie Ägypten, der Türkei, Brasilien sowie der Konflikt in Syrien, der bei einer möglichen Intervention der USA zu eskalieren droht. Diese Konflikte sind auf den Radarschirm von Investoren geraten, deren Optimismus nur wenige Jahre zuvor nicht wesentlich von den Unruhen in Libyen, Tunesien oder Mali getrübt schien.
Fondsanbieter trennen sich nur ungern von ihrer Vertriebsstory
Angesichts dieser unübersichtlichen Gemengelage stellt sich vielen Investoren die Frage, ob es sich um eine Krise der Schwellenländer handelt - und wie tief sie wirklich ist. Geht es heute nur um die Überwindung einer Wachstumsdelle, wie man sie regelmässig aus dem typischen Auf und Ab der Konjunkturzyklen kennt, oder geht das Problem tiefer?
Wenig überraschend die Reaktion der Fondsanbieter, die bisher blendend an der Wachstumsphantasie für die Schwellenländer verdient haben. Spätestens seitdem Goldman Sachs im Jahr 2001 die BRIC-Ära ausgerufen hat, ist die Emerging-Markets-Story ein fester Bestandteil des Produkt- und Vertriebsmarketings der Investmentindustrie.
Schwellenländeraktien- und Bondfonds haben in den vergangenen Jahren extrem hohe Zuflüsse von Anlegern auf sich gezogen. In globale Aktienfonds für Schwellenländer haben europäische Investoren in den vergangenen fünf Jahren gut 64 Milliarden Euro netto investiert, 78 Milliarden Euro flossen in Schwellenländer-Bond-Fonds, der Großteil davon in Fonds für lokale Währungen. Von dergestalt liebgewonnenen Vertriebsstories trennt man sich nun einmal ungern.
Emerging Markets seien nach wie vor ein „interessantes Investmentterrain“, heisst es etwa bei der Vermögensverwaltung der Deutschen Bank, die altbekannte Argumente pro Schwellenländer ins Feld führt: der Wachstumsvorsprung gegenüber den etablierten Volkswirtschaften, der Binnenkonsum, die niedrigen Schulden sowie das demografische Wachstum.
In Schwellenländer-Aktienfonds wurden seit 2008 64 Milliarden Euro netto investiert, 78 Milliarden flossen in Schwellenländer-Bond-Fonds. Von solchen Vertriebsstories trennt man sich ungern.
„Chancen nach der Korrektur“, wittert Fisch Asset Management für Emerging-Markets-Anleihen, und auch der schwedische Asset Manager East Capital trommelt für Investments in Emerging Markets, die auf dem derzeitigen Niveau attraktiv bewertet seien. In diesen Tagen trifft man auch häufig auf beschwichtigende Kommentare, die derzeitigen Marktturbulenzen seien kein Vorbote einer zweiten Asienkrise. Die Schwellenländer, so der Tenor, seien heute fundamental viel besser aufgestellt als 1997. Die strukturellen Schwachstellen in vielen Ländern seien beseitigt, heisst es etwa bei LGT Capital Management.
Doch an dieser Stelle sollte man innehalten. Wenn die Jahrhundertkrise der südostasiatischen Länder bereits als Referenzgrösse genannt wird, ist ein Realitätscheck dringend angesagt.
Wo stehen wir heute? Derzeit flüchten Kapitalanleger aus den Schwellenländern in einem atemberaubenden Tempo. Nachdem sich die Abflüsse sich im Juli abgeschwächt hatten, brachen im August offenbar wieder die Dämme. In der Woche per 4. September zogen Anleger weltweit 6,1 Milliarden US-Dollar aus Schwellenländeraktien- und Bond-Fonds ab. „Anleger kapitulieren“, lautet das Fazit der Bank of America Merrill Lynch. Die Bank rechnet vor, dass weltweit in den vergangenen drei Monaten 60 Milliarden US-Dollar aus Schwellenländerfonds abgeflossen sind. Unsere Monatsdaten zu Geldflüssen in Fonds zeigen ein ähnliches Bild. Auch ETF-Anleger suchen das Weite. Knapp vier Milliarden US-Dollar wurden alleine in der letzten Augustwoche aus Schwellenländer-Index-Vehikeln abgezogen.
Wenn das spekulative Geld, das in Schwellenländer in der Vergangenheit investiert wurde, heute in einem ähnlich rapiden Tempo wieder abfliesst, ist Vorsicht angesagt. Derzeit geht es für Anleger nicht um die Frage, ob das Wirtschaftswachstum der Schwellenländer intakt ist, sondern vielmehr um die möglichen Folgen des rasanten Liquiditätsentzugs. Finanzschocks können sich sehr schnell auf die Realwirtschaft übertragen – der Fall Lehman lässt grüssen.
Fest steht jedenfalls, dass sich die Richtung der Geldflüsse im Zuge der neuen Linie der US-Notenbank um 180 Grad gedreht hat. Mit verheerenden Folgen für die lokalen Währungen. Am stärksten erwischte es in den vergangenen drei Monaten die indische Rupie, die in diesem Jahr knapp 16 Prozent verloren hat – alleine in den vergangenen zwei Monaten verlor die Rupie (per 6. September) knapp 30 Prozent. Zu den grossen Verlierern zählt auch der brasilianische Real.
Entsprechend hektisch fallen die Reaktionen der Schwellenländer aus. Sie werfen derzeit massiv US-Treasuries auf den Markt, um ihre schwächelnden Währungen zu stützen. Seit Ende Juni verkauften die Notenbanken der Emerging Markets Treasuries im Wert von 48 Milliarden US-Dollar. Besonders aktiv war Thailand mit Verkäufen im Umfang von 18 Milliarden Dollar. Interessant ist, dass diese Umschichtungen den Renditeanstieg bei Treasuries begünstigen, was wiederum den verstärkten Kapitalabzug von US-Investoren aus den Schwellenländern befeuern könnte.
Brasilien will mit Liberalisierungsschritten um Devisen kämpfen
An dieser Stelle stellt sich die Frage, wie komfortabel die Liquiditätspolster der Notenbanken in den Schwellenländern wirklich sind. Auch wenn die Schwellenländer seit Ende der 1990-er Jahre Devisenreserven deutlich aufgestockt haben, könnten die Puffer in den kommenden Monaten dahinschmelzen.
Stichwort Brasilien: Die Fremdwährungsreserven betrugen zuletzt rund 370 Milliarden US-Dollar. Das klingt nach viel. Diese Summe wird jedoch dadurch relativiert, dass die brasilianische Notenbank alleine zur Stützung des schwachen Real bis Ende dieses Jahres 55 Milliarden Dollar aufwenden will. Nachdem Brasilien in den vergangenen Jahren darauf bedacht war, den Kapitalfluss aus dem Ausland zu bremsen, um die Inflation einzudämmen, werden nun die Schleusen geöffnet. So wurde jüngst die Finanztransaktionssteuer für ausländische Investoren abgeschafft, und die Leitzinsen wurden in mehreren Schritten zwischen April und Ende August von 7,25 Prozent auf 9,0 Prozent erhöht.
Eine konträre Vorgehensweise wählen die Entscheidungsträger in Indien. Hier wurden die Kapitalkontrollen zuletzt verstärkt. Die Notenbank begrenzte die Geldbeträge, die Privatpersonen und Unternehmen ins Ausland transferieren dürfen. Man versucht, mit staatlichen Massnahmen die Kapitalflucht zu bremsen. Die Lage für das Land ist alles andere als beruhigend: Mit einem Leistungsbilanzdefizit von fast sieben Prozent (per Ende 2012) ist Indien auf ausländische Kapitaltransfers angewiesen. Problematisch ist, dass der Anteil der kurzfristigen Schulden an den Gesamtschulden in den vergangenen Jahren stark zugenommen hat.
Kapitalbedarf Indiens 2014 nur knapp gedeckt
Die Zeitschrift Economist taxiert den Kapitalbedarf Indiens im kommenden Jahr auf 250 Milliarden US-Dollar. Die Summe ergibt sich aus den 2014 fälligen Schulden plus das Leistungsbilanzdefizit von geschätzt vier bis fünf Prozent des BIP. Dem stehen Währungsreserven von 279 Milliarden Dollar gegenüber, was einer Coverage Ratio von 1,1 entspricht – deutlich unter dem Niveau der vergangenen acht Jahre.
Auch Indonesien hat mit Kapitalabflüssen und einer akuten Währungsschwäche zu kämpfen. Neben der Einführung von Zöllen auf Luxusgüter wurden die Leitzinsen in den vergangenen zwei Monaten von 5,75 Prozent auf 7,0 Prozent angehoben. Neben Brasilien, Indien und Indonesien gelten auch die Türkei und Südafrika infolge ihrer hohen Leistungsbilanzdefizite als besonders wackelig. In Zeiten immer knapper werdender Liquidität gelten Länder wie Chile, Mexiko, Malaysia und Russland indes als relativ solide (was freilich die Währungen dieser Länder nicht vor empfindlichen Abwertungsrunden zu schützen vermochte).
In diesen Tagen wird schlaglichtartig deutlich, wie stark die Schwellenländer am Tropf der westlichen, vor allem der amerikanischen, Geldpolitik hängen. Hatte die Niedrigzinspolitik über weite Strecken des Millenniums für massive Geldtransfers in die aufstrebenden Märkte gesorgt, leitet der Umschwung der US-Geldpolitik die Geldflüsse in die andere Richtung – mit potenziell verheerenden Folgen für die Schwellenländer.
Wie gross ist der Stress für Schwellenländer heute?
Doch wie gefährdet ist die finanzielle Stabilität der Schwellenländer? Es gibt diese Tage etliche Versuche, dies zu taxieren. Der Economist hat jüngst einen Index geschaffen, der die Verletzlichkeit von 26 Schwellenländern misst. Der Capital-Freeze Index bewertet die Anfälligkeit dieser Länder für Kapitalabflüsse. Die „Krisenampel“ besteht aus den vier Indikatoren Leistungsbilanzdefizit, Kreditwachstum, kurzfristige Auslandsschulden und externe Verschuldung im Verhältnis zu den Währungsreserven.
Wie aus der unteren Grafik hervorgeht, steht die Türkei am schlechtesten da, gefolgt von Kolumbien, Südafrika, Argentinien, Brasilien, Ukraine und Venezuela. „Gelb“ ist die Ampel unter anderem für Indien, Indonesien, Thailand und die Philippinen. Deutlich besser sieht es für die „grünen“ Länder Russland, China, Algerien, Saudi Arabien und Ungarn aus.
Grafik: Der Capital-Freeze-Index zeigt am meisten Stress für die Türkei an

Quelle: Economist
Einen breiteren anderen Ansatz, der die heutige Situation zudem in den historischen Kontext setzt, hat die Bank of America Merrill Lynch gewählt. Sie hat ein Krisenbarometer für asiatische Schwellenländer erstellt, das zehn Faktoren beinhaltet, unter anderem das Kreditwachstum der vergangenen drei Jahre, den Spread zwischen Kreditwachstum und Wirtschaftswachstum, das Verhältnis zwischen Verschuldung und Bankeinlagen, die Volatilität der Wechselkurse, die Performance von Finanzaktien und das Verhältnis zwischen Leistungsbilanzdefizit und Bruttoinlandsprodukt.
Diese zehn Faktoren wurden bis ins Jahr 1990 zurückgerechnet und die aktuellen Werte in Relation zum historischen Durchschnitt der letzten 23 Jahre gesetzt. Für sechs der neun untersuchten Märkte ergibt sich erheblicher Stress. Im Ergebnis leiden die Länder unter den Folgen eines wuchernden Kreditwachstums unter den Bedingungen eines liberalisierten Finanzmarktregimes, „Wir befinden uns nicht im Jahr 1997, aber wir sind auch nicht allzu weit davon entfernt“, lautet das ernüchternde Fazit der Bank of Amerika Merrill Lynch.
Die unten dargestellte Heat Map bildet den Stressfaktor ab. Sie zeigt, dass Taiwan und Korea relativ zu ihrem historischen Durchschnitt gut und Thailand einigermassen solide dastehen. Die Finanzsysteme der andern untersuchten asiatischen Märkte stehen unter starkem Druck, wie die rot gefärbten Felder zeigen. Vor allem Indien, Malaysia und – überraschenderweise – Singapur weisen erhebliche Stressgrade auf.
Grafik: Heat Map für zehn asiatische Schwellenländer: Indien, Singapur und Malaysia unter Strom

Quelle: Bank of America Merrill Lynch
Vor diesem Hintergrund könnten Anleger zu einer anderen Bewertung der Lage in den Schwellenländern gelangen, als es die eher beschwichtigenden Einschätzungen vieler Asset Manager nahelegen. Es spricht einiges dafür, dass der Beginn des „Taperings“ und seine Folgen mit weiteren Verwerfungen in den Schwellenländern einhergehen wird.
Liberalisierung ade - Russland und China als neue Vorbilder?
Den Verantwortlichen in den Schwellenländern dürften die derzeit zu beobachtenden Turbulenzen die Anfälligkeit gegenüber externen Schocks eindrücklich vor Augen führen. Als Konsequenz dürften die Liberalisierung der Finanzmärkte und der Öffnung der Schwellenländer für ausländische Finanzinvestitionen auf den Prüfstand gestellt werden. Die Tatsache, dass die am wenigsten offenen Finanzsysteme China und Russland die Turbulenzen bisher am besten überstanden haben, dürfte den Verantwortlichen nicht verborgen geblieben sein.
Der freie Kapitalverkehr steht nun einmal in engem Zusammenhang mit dem Verlust der monetären Unabhängigkeit. Offene, in das globale Finanzsystem integrierte Märkte können sich nicht gegen spekulative Investmentgelder abschotten, die ungehindert über den Globus fliessen – in die eine wie in die andere Richtung.
Investoren aus dem Westen dürften sich deshalb mittelfristig mit verstärkten Abschottungstendenzen in den Schwellenländern konfrontiert sehen. „Unsere vorrangige Sorge gilt Kapitalverkehrskontrollen und Enteignungen“, sagte jüngst Mark Mobius, Leiter Emerging Markets bei Franklin Templeton. Nicht zuletzt deshalb dürften besorgte Investoren zuletzt verstärkt ihr Geld aus Indien abgezogen haben. Auch hier liefert die Asienkrise der 1990er Jahre einen interessanten Präzedenzfall – Malaysia fror im Jahr 1998 ausländische Investments in grossem Stil ein.
Doch diese Erkenntnis kommt zu spät, um den Gang der Dinge kurzfristig beeinflussen zu können. Zunächst geht es um die Kontrolle der akuten Krise. Dazu gibt es zahlreiche Ansätze. Neben den Kapitalfluss-Restriktionen in Indien, der Abschaffung der Finanztransaktionssteuer in Brasilien, den allgemeinen Zinserhöhungen gibt es Pläne für gemeinsame Interventionen der Notenbanken der Schwellenländer, um die gebeutelten Währungen zu stützen.
Gut möglich, dass Investoren in Emerging Markets Bonds und Aktien in den nächsten Wochen eine weitere ungemütliche Phase bevorsteht.
Ob diese Schritte die Turbulenzen nachhaltig beruhigen werden, steht in den Sternen. Wesentlich konkreter ist die Gefahr, die sich in Washington zusammenbraut. Die US Notenbank wird in den nächsten Tagen aller Voraussicht nach ein Zurückfahren ihres Anleihe-Rückkaufprogramms ankündigen und zügig damit beginnen, ihre die Ende Mai angekündigte Strategie in die Tat umzusetzen.
Gut möglich, dass Investoren in Emerging Markets Bonds und Aktien in den nächsten Wochen eine weitere ungemütliche Phase bevorsteht.
In den nächsten Wochen werden wir uns näher mit Fonds für Schwellenländer-Aktien und - Bonds befassen. Bleiben Sie also dran!