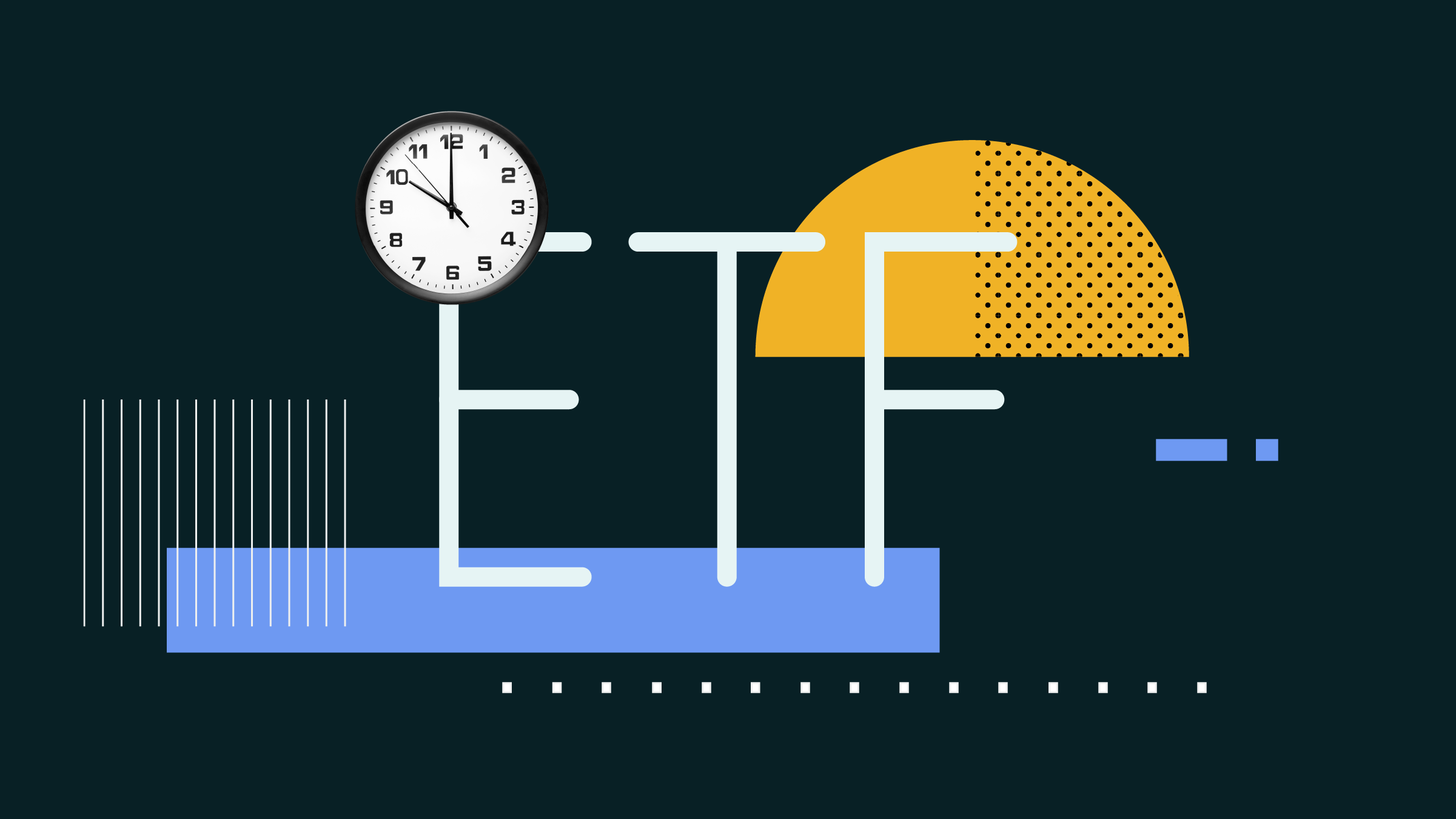Wer in diesen Tagen über die Verhaltensweisen von Privatanlegern spricht, könnte den Eindruck gewinnen, dass die Rede von einem scheuen Reh ist: Wie lange halten Investoren bei Verlusten still und wann geben sie Fersengeld und verkaufen ihre Fonds oder Aktien? „Unsere Umfragen haben ergeben, dass die Grenze bei vielen Investoren etwa bei 10% liegt“, sagte Manfred Hübner, Kapitalmarktexperte und Fondsmanager bei Sentix Asset Management, auf der diesjährigen Morningstar Investment Conference am 14. November in Frankfurt.
Anders argumentierte auf unserer Konferenz Luca Pesarini, der den defensiven Mischfonds Ethna Aktiv managt. Er zieht die Grenze bei 4-5%. Pesarinis Ziel ist es, in jedem Jahr Verluste zu vermeiden. Dass das 2008 und 2011 nicht gelang, haben ihm Anleger indes offenbar nicht übelgenommen. Der Ethna Aktiv E zählt mit einem Fondsvermögen von 2,27 Milliarden Euro zu den Schwergewichten unter den Mischfonds am Markt. Der maximale Verlust beim Ethna Aktiv betrug in einem Kalenderjahr 3,9%. Das war 2008.
Wer 2008 kein Geld verlor, hat Quasi-Legendenstatus erlangt
Die Diskussion über Verlustgrenzen kommt nicht von ungefähr. Seitdem Edouard Carmignac mit dem Mischfonds Carmignac Patrimoine das Kunststück vollbrachte, im annus horibilis 2008 ein minimales Plus von 0,01% zu erzielen und daraufhin eine zweistellige Milliarden-Euro-Summe an Nettomittelzuflüssen verzeichnete, spricht man in der Fondsbranche nur noch von Risikokontrolle und Risikomanagement. Wer Verluste vermeidet und in freundlichen Märkten einigermaßen mitläuft, hat heute quasi die Lizenz zum Gelddrucken erworben.
Die Diskussion ist inzwischen sogar bei Aktienfonds angekommen. „Aktienfonds haben es bisher als Aufgabe gesehen, auf Einzeltitelebene Alpha zu generieren. Die Frage ist, ob sich die Zeit nicht verändert hat. Sollte ein einzelner Aktienfonds nicht aktiver gesteuert werden, also in schlechten Phasen Cash aufgebaut werden? Dies passiert aus Sicht der Privatanleger immer noch viel zu selten“, so Steffen Selbach, Leiter Vermögensverwaltung der Deka-Bank, auf einer Morningstar-Diskussionsveranstaltung im August.
Auch Dividendenfondsmanager heben gerne hervor, dass Dividenden einen Sicherheitspuffer bieten und das eine Art Risikomanagement darstelle (was angesichts der hohen drawdowns bei Aktien-Dividendenfonds einigermaßen skurril anmutet).
Risikobudgets von 10% erlauben hohe drawdowns
Die Frage, wo die Verlustgrenze beim typischerweise konservativen Anleger liegt, ist also nicht trivial. Die viel bemühte 10-Prozent-Toleranzgrenze impliziert eine Wertuntergrenze von 90% beim Fondsvermögen. Mit einem derart üppigen Risikobudget ausgestattete Fonds können unterjährig durchaus ordentliche Drawdowns vertragen. Darf es also ein aggressiver Mischfonds mit Aktienquoten von bis zu 75% sein? Anders wäre der Fall gelagert bei einem maximal tolerierbaren Verlust von 4%. Verträgt der typische Anleger also doch nur defensive Mischfonds mit einer Aktienquote von maximal 25, 30 oder 35%?
Vorweg gesagt: Es spricht viel dafür, dass Anleger deutlich konservativer sind, als es die üblichen Bandbreiten bei Mischfonds und Risikoprofile in den Beratungsprotokollen der Banken vermuten lassen. Viele Anleger dürften heute auf Nummer sicher gehen und – wenn überhaupt – auf Fonds mit konservativen Risikoprofilen und entsprechend niedrigen Aktienquoten setzen. Das impliziert, dass viele Debatten über Aktienquoten ins Leere laufen, da sie eine zu hohe Risikobereitschaft bei Anlegern voraussetzen.
Die Lehre der Verhaltensökonomie hilft weiter
Eine Annäherung an die Verlusttoleranz bei Anlegern ermöglichen Erkenntnisse aus der Behavioural-Finance-Forschung. Interessant ist dabei die Wirkung der Volatilität, also die Schwankungsintensität des Fondspreises bzw. des Aktienkurses. Behavioural Finance, auch die Lehre der Verhaltensökonomie genannt, ist – kurz gesagt – eine wissenschaftliche Disziplin, die den typischen menschlichen Affekten auf den Grund geht, die das Anlegerverhalten bestimmen.
Oft verleiten Emotionen Anleger zu Investment-Entscheidungen, die suboptimale Ergebnisse bringen. Die selektive Wahrnehmung von Fakten, die systematische Überschätzung der eigenen Fähigkeiten sind zwei typische Muster, die beispielsweise dazu führen, dass Investoren viel zu lange an Verlustbringern in ihren Portfolios festhalten. Wir haben dieses Phänomen wiederholt an dieser Stelle aufgegriffen (lesen Sie hier mehr).
Doch wie bekommt man die Frage nach der tatsächlichen Risikoaversion von Investoren in den Griff? Hal Ratner, Chief Investment Officer von Morningstar in Europa, hat ein Experiment vorgenommen. Er hat anhand der Entwicklung des US-Aktien-Index S&P 500 zwischen 1926 und 2012 die Wahrnehmung unterschiedlicher, typisierter Investorengruppen auf der Grundlage des so genannten Sicherheitsäquivalents (Englisch: Certainty-Equivalent) berechnet.
An dieser Stelle müssen wir ein wenig ausholen, um diese mathematische Rechnung zu erläutern, die eigentlich nicht aus der klassischen Finanzwissenschaft kommt, sondern eher dem Bereich der Psychologie zuzuordnen ist. Das Sicherheitsäquivalent ist – kurz gesagt – eine Kosten-Nutzen-Funktion, die den (höchst subjektiven) Erwartungswert von Anlegern zu quantifizieren versucht.
Volatilität verursacht auch den Hartgesottenen Stress
Anleger nehmen Verluste typischerweise stärker wahr als spiegelbildliche Gewinne. Ein Verlust von 10% schmerzt Investoren mehr, als ihnen ein 10-prozentiger Gewinn Freude macht. Unsere Kennzahl „Morningstar Risk Adjusted Return“ funktioniert genau nach diesem Prinzip: Volatile Anlagen bekommen einen „Abschlag“, um den Nutzen einer Anlage für möglichst viele Anleger, die tendenziell risikoavers sind, einzufangen und so dem subjektiven Empfinden von Anlegern Rechnung zu tragen. Wenn Sie mehr über den Morningstar Risk Adjusted Return lesen und auch die Formeln nachvollziehen möchten, lesen Sie hier weiter.
Kommen wir nun zu unserem Beispiel zurück, das Morningstar-Experte Ratner aufgemacht hat. In den vergangenen 86 Jahren erwirtschaftete der S&P 500 pro Jahr eine Durchschnittsrendite von 9,9% bei einer Standardabweichung von 19,1%, wie auf der linken Seite der beige unterlegten Zeile der Tabelle unten hervorgeht. Setzen wir voraus, dass eine – fiktive - Anlegergruppe ein entsprechendes Indexportfolio über diesen Zeitraum besessen hat, das ein identisches Rendite-Risiko-Profil wie der US-Standardwerteindex aufweist. Es gibt 8 verschiedene Anlegergruppen, wobei die Gruppe 1 sehr risikotolerant, Gruppe 8 auf der anderen Seite der Skala sehr risikoscheu ist.
Tabelle: Gestresste Anleger nehmen Renditen niedriger wahr

Rendite und Volatilität in %, S&P-Daten zwischen 1926 und 2012, Quelle: Morningstar
Nur ein gänzlich „objektiver“ Anleger hätte die Performance des Indexportfolios zwischen 1926 und 2012 so wahrgenommen, wie sie sich tatsächlich entwickelt hat. Typischerweise hätten Anleger das Plus von 9,9 pro Jahr aber ganz anders wahrgenommen. Interessant ist dabei, dass selbst risikoaffine Anleger der Gruppe 1 angesichts der recht hohen Volatilität von 19,1% eine gefühlte Rendite von 7,9 statt 9,9% vereinnahmt haben. Volatilität verursacht also auch den Hartgesottenen Stress!
Aus Plus 9,9% mach minus 62,4%!
Je weiter wir uns nach rechts in der beige unterlegten Zeile bewegen, desto weniger ausgeprägt fällt die ist die Freude über das Plus von 9,9% aus. Stark risikoscheue Anleger der Gruppe 8 hätten den Gewinn sogar als Verlust von 7,8% wahrgenommen! Das liegt an den zwischenzeitlich extremen Abwärtsphasen von bis zu minus 43% in einem Jahr beim S&P 500.
Anschließend hat Hal Ratner mit einem Volatilitätsregler die variierenden Kosten-Nutzen-Erwartungen von Anlegern unter der Bedingung konstanter Renditen taxiert. Wäre die Rendite von 9,9% mit einer Volatilität von 28,9% erzielt worden, hätte der risikotolerante Anleger gefühlt nur eine Rendite von 5,4% vereinnahmt; bei einem risikoaversen Investor wäre das Plus von 9,9% in ein Minus von 31,8% umgeschlagen.
Noch extremer das Bild bei einer angenommenen Standardabweichung von 38,8%. Hier wäre der Gewinn von 9,9% von gestressten Anlegern der Gruppe 8 sogar als Verlust von gut 62% angekommen!
Wem diese Rechnung überzogen vorkommt, der möge sich selbst testen: Wie haben Sie den 20% Verlust beim Dax an nur 4 Handelstagen im August 2011 wahrgenommen? Nur 13 Monate später hatte der Dax sich um gut 40% von dem seinerzeitigen Tief abgesetzt! Noch dramatischer dürften Sie die Kursstürze vom Herbst 2008 erlebt haben. Hand aufs Herz: Haben Sie seinerzeit beherzt Aktien oder Aktienfonds nachgekauft, oder haben Sie sich der Herde angeschlossen und verkauft?
Die Implikationen aus diesem Beispiel sind nicht trivial. Berater müssen sich im Klaren sein, dass Anleger vermutlich viel risikoscheuer sind, als es gemeinhin vermutet wird. Fondsanbieter ihrerseits müssen den Spagat hinbekommen, Sicherheitsnetze zu spannen, ohne den Renditeaspekt komplett zu vernachlässigen. Der Hebel muss allerdings in erster Linie dort angesetzt werden, wo er am effektivsten wirkt – nämlich beim Anleger. Wer sich bewusst macht, zu welchen Fehlern und Fehleinschätzungen er neigt, wird am ehesten in der Lage sein, seine Emotionen zu kontrollieren und das Geschehen an den Märkten richtig einzuordnen – und somit am ehesten in der Lage sein, gegen den langfristig destruktiven prozyklischen Strom zu schwimmen.